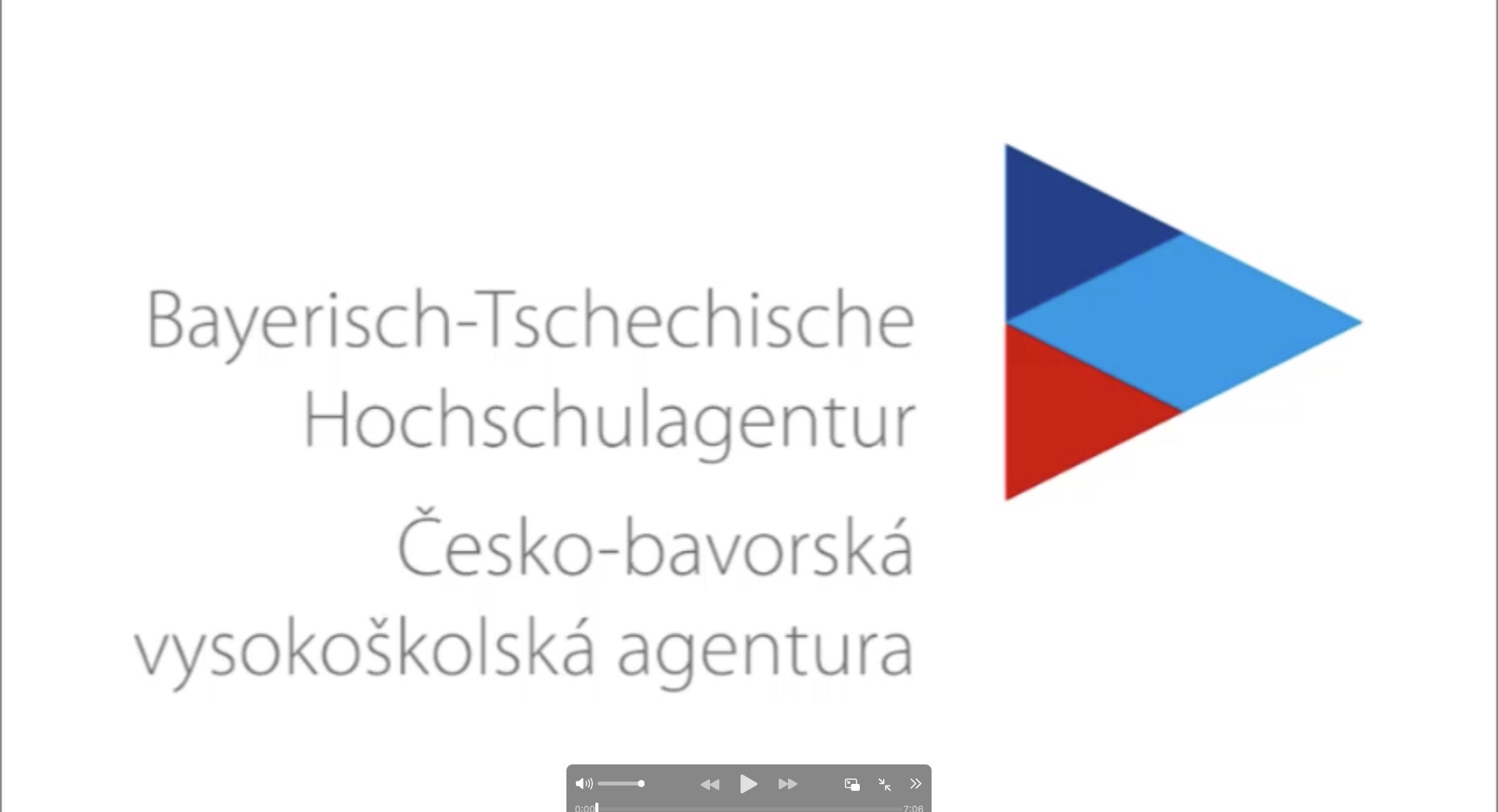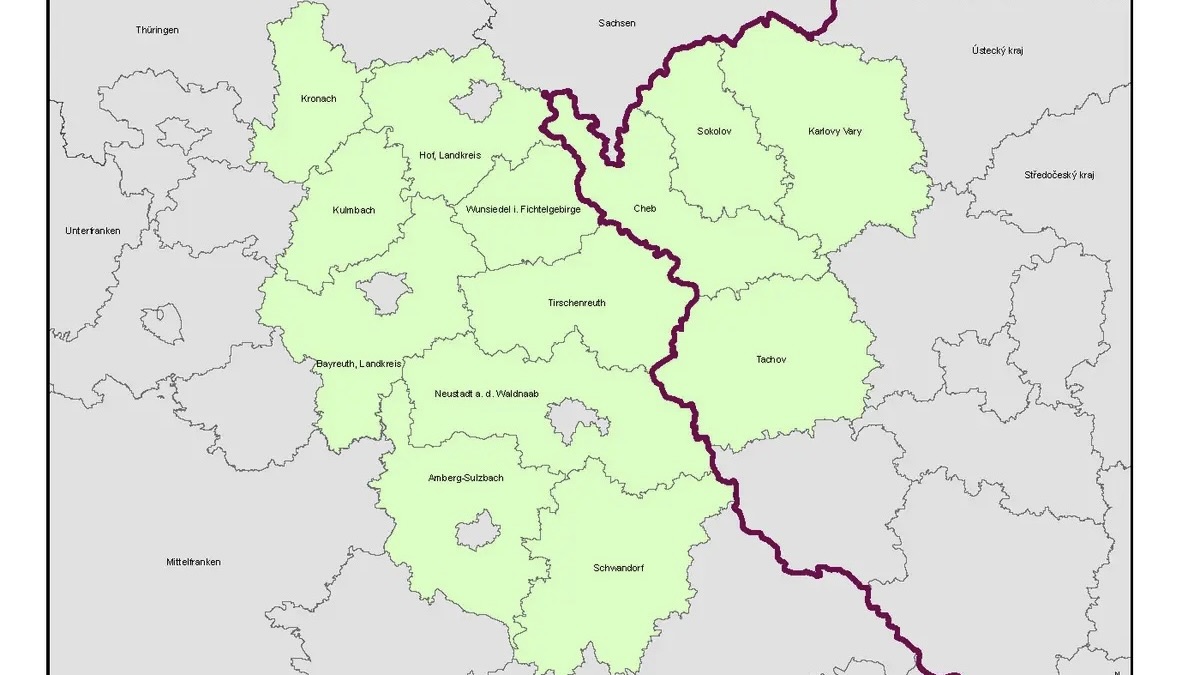Aus dem Forschungsalltag · 05. Juni 2025
Ausstellung zur Historischen Geographie eines untergegangenen Dorfes im Freilichtmuseum Finsterau
Aus dem Forschungsalltag · 28. Mai 2025
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt ein dreijähriges Forschungsprojekt zur westdeutschen Geschichte der Historischen Regionalgeographie im 20. Jahrhundert
Aus dem Forschungsalltag · 08. April 2024
Tagung des Arbeitskreises Geschichte der Geographie in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) am 28. und 29. Juni 2024 an der Universität Bonn
Aus dem Forschungsalltag · 09. Februar 2024
Jahrestagung der Akademie für geographische Regionalforschung 2024 in Bamberg
Aus dem Forschungsalltag · 08. Dezember 2023
Dissertation in der Reihe "Historische Geographie/Historical Geography" im LIT Verlag erschienen
Externer Beitrag · 08. November 2023
Die Universität Bamberg hat dem IfL-Forscher Patrick Reitinger den Otto-Meyer-und-Elisabeth-Roth-Preis 2023 verliehen
Aus dem Forschungsalltag · 27. März 2023
Workshop des Arbeitskreises für historische Kulturlandschaftsforschung (ARKUM) in Tübingen
Aus dem Forschungsalltag · 24. Januar 2022
CfP für einen Workshop des Arbeitskreises für historische Kulturlandschaftsforschung (ARKUM) in Bamberg
Interview · 18. November 2021
Interview mit der Bayerisch-Tschechischen Hochschulagentur zu den Erfahrungen in der wissenschaftlichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Pressemitteilung · 06. Oktober 2021
Eine Studie der Universitäten Bamberg und Ústí nad Labem untersucht die Grenzschließungen zwischen Bayern und Tschechien während der Corona-Pandemie.